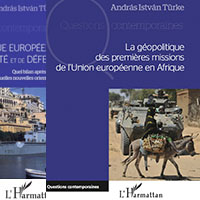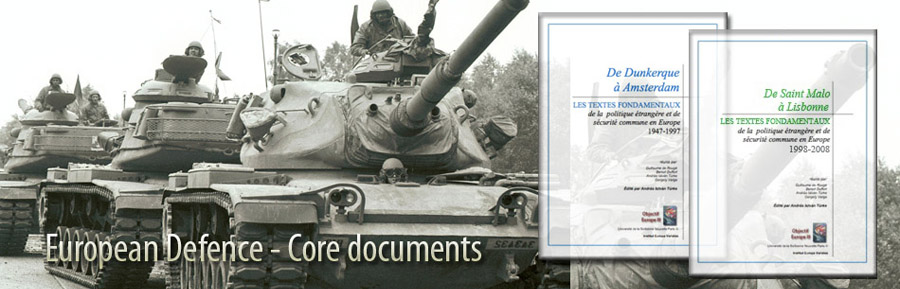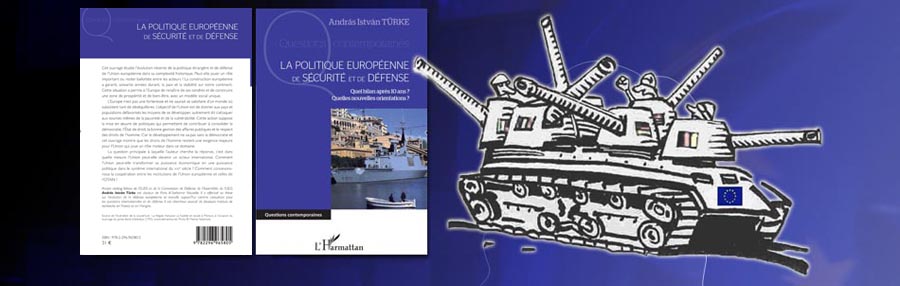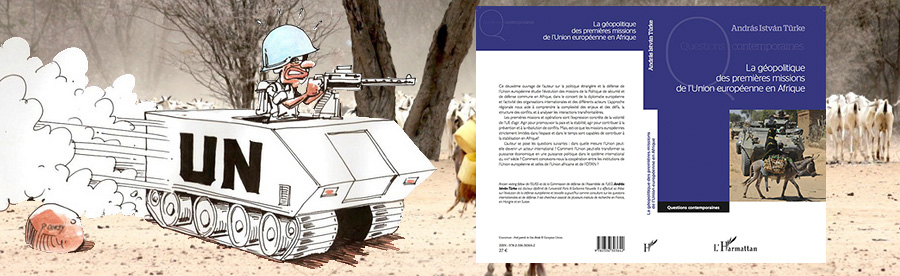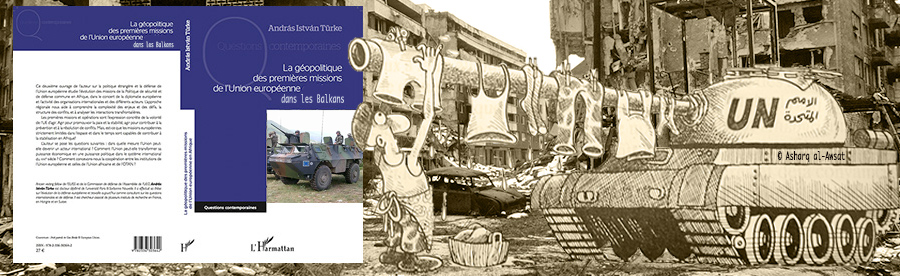You are here
Afrique
European allies back Zelenskyy after Trump criticism
Sweden acquits activists who smeared paint on Monet painting
Nucléaire : l’Algérie obtient le soutien technique de l’AIEA pour plusieurs projets stratégiques
L’Algérie consolide son engagement dans le nucléaire pacifique grâce à une déclaration commune avec l’AIEA visant à développer des applications dans l’énergie, l’eau et l’agriculture. […]
L’article Nucléaire : l’Algérie obtient le soutien technique de l’AIEA pour plusieurs projets stratégiques est apparu en premier sur .
EU denies it has fined Elon Musk for violating digital rules
Coupe du monde 2026, Argentine, Scaloni, CAN 2025… les révélations de Petkovic
Dans une interview accordée au média sportif « El-Heddaf », le sélectionneur national Vladimir Petkovic revient sur le tirage au sort de la Coupe du monde-2026. Il […]
L’article Coupe du monde 2026, Argentine, Scaloni, CAN 2025… les révélations de Petkovic est apparu en premier sur .
Mail for Musk? Elon shows up on Parliament employee list
STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2024/1348 in Bezug auf die Erstellung einer Liste sicherer Herkunftsländer auf Unionsebene - PE776.982v02-00
Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
Marco Tarquinio
Quelle : © Europäische Union, 2025 - EP
Greek farmers block Crete airports as row over farm subsidies escalates
Repas empoisonnés, faux papiers : une nourrice algérienne jugée pour antisémitisme en France
Une femme algérienne de 42 ans, Leila, fera face mardi au tribunal correctionnel de Nanterre, où elle sera jugée en détention pour administration de produits […]
L’article Repas empoisonnés, faux papiers : une nourrice algérienne jugée pour antisémitisme en France est apparu en premier sur .
La violence numérique en hausse : Pourquoi les femmes sont-elles exposées à des risques accrus et comment peuvent-elles se protéger ?
10 Omras des TV et d’autre cadeaux InDrive célèbre ses meilleurs chauffeurs en Algérie
InDrive, l’application de transport numéro 1 en Algérie, a célébré les gagnants de son Concours d’été, lancé en juillet, lors d’un événement spécial de reconnaissance […]
L’article 10 Omras des TV et d’autre cadeaux InDrive célèbre ses meilleurs chauffeurs en Algérie est apparu en premier sur .
Algérie vice-présidente du comité droit d’auteur de l’OMPI
L’Algérie, représentée par le Directeur général adjoint de l’Office national du droit d’auteur et des droits voisins, M. Mehdi Dalmi, a été élue Vice-présidente du […]
L’article Algérie vice-présidente du comité droit d’auteur de l’OMPI est apparu en premier sur .
Les militants UP-R se mobilisent à la Place Bulgarie pour dénoncer le coup de force
Ce lundi 08 décembre 2025, une forte mobilisation de militantes et militants du parti Union progressiste le renouveau (UP-R), est prévue à la Place Bulgarie à partir de 14h30. L'annonce a été faite par Sèdami Mèdégan Fagla, ministre conseillère, membre du parti UP-R.
Des militantes et militants UP-R à la Place Bulgarie dans l'après-midi de ce lundi 08 décembre pour dénoncer le coup de force perpétré par un groupe de mutins dans la journée du dimanche 07 décembre 2025 au Bénin. L'annonce a été faite par la ministre conseillère, Sèdami Mèdégan Fagla, membre du parti UP-R. A travers une publication sur sa page Facebook, elle a lancé un appel à une forte mobilisation pour « Dire non à toute forme de prise de pouvoir par la force ».
Plus de détails à venir.
Edouard Loko exprime son sa solidarité au personnel de la SRTB
Au lendemain de la tentative de coup d'Etat mise en échec par l'Armée béninoise, le président de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication (HAAC), Edouard Loko, s'est rendu ce lundi 8 décembre 2025, à la direction générale de la Société de radiodiffusion et de télévision du Bénin (SRTB). Le président de l'institution en charge de la régulation des médias au Bénin est allé exprimer sa solidarité et son soutien au personnel de la Télévision de service public.
La HAAC exprime son soutien et sa solidarité au personnel de la SRTB. Le président, Edouard Loko à la tête d'une délégation s'est rendu dans la matinée de ce lundi 08 décembre 2025, dans les locaux de la Télévision nationale, pris d'assaut par le groupe de mutins ce dimanche 07 décembre. Il a salué à l'occasion, le professionnalisme dont les agents ont fait preuve durant les événements, et leur capacité à maintenir la continuité du service public de l'information malgré la situation.
Le président de la HAAC a précisé au cours de sa visite que les faits qualifiés de coup d'État avaient été déjoués. Il a réaffirmé la détermination de l'institution qu'il préside à accompagner les médias dans l'exercice de leurs missions. Au-delà des règles de déontologie », l'institution entend désormais « exiger du patriotisme de tous les médias ».
Cette démarche du président de la HAAC est saluée par le personnel de la SRTB et l'ensemble des acteurs de la presse béninoise.
F. A. A.
Meta to tweak its pay-or-consent ad model for EU users in January
Alger : arrestation d’un hacker impliqué dans plus de 140 000 attaques numériques
Un hacker actif depuis 2020 arrêté à Alger. Plus de 140 000 attaques liées à son réseau. Matériel saisi et enquête approfondie. Les services de […]
L’article Alger : arrestation d’un hacker impliqué dans plus de 140 000 attaques numériques est apparu en premier sur .
L'EPMB exprime soutien spirituel et institutionnel au chef de l'Etat
A l'instar de plusieurs autres confessions religieuses, l'Eglise protestante méthodiste du Bénin (EPMB), a condamné la tentative de prise de pouvoir par les armes survenue dans la journée du dimanche 07 décembre 2025 au Bénin. A travers un communiqué signé de Son éminence, Révérend Amos Hounsa, l'EPMB a exprimé son soutien spirituel et institutionnel au chef de l'Etat et rassure de ses prières constantes pour la pérennisation de la paix dans le pays
Le communiqué de l'EPMB
De la définition au traitement : tout savoir sur le syndrome cérébelleux (malformation de Chiari)
La malformation de Chiari (MC) désigne une anomalie anatomique complexe de la jonction crânio-cervicale. Le cervelet, partie postérieure du cerveau responsable de l’équilibre, s’affaisse. Plus […]
L’article De la définition au traitement : tout savoir sur le syndrome cérébelleux (malformation de Chiari) est apparu en premier sur .
SCIP Database under review as EU moves to simplify waste rules
Pages
the old site is here